 Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, (möglichst) alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Wer sich beteiligen möchte, aber keinen Blog hat, kann gerne einen Beitrag einreichen – er wird dann als Gastbeitrag publiziert. Dies ist die neunte Runde.
Vorbemerkung: Eine Reihe von bildungsaffinen Bloggern hat sich zum Ziel gesetzt, 2024 häufiger thematisch gemeinsam zu bloggen. Die Themenvorschläge werden an dieser Stelle gesammelt, (möglichst) alle Beiträge zum aktuellen Thema sind unter dem Beitrag zu finden. Wer sich beteiligen möchte, aber keinen Blog hat, kann gerne einen Beitrag einreichen – er wird dann als Gastbeitrag publiziert. Dies ist die neunte Runde.
Wir haben es geschafft. Mal wieder. Der Dezember huscht wie jedes Jahr im Eiltempo an mir vorüber. Schulaufgaben, Notenstandsberichte, Probezeitkonferenzen, dazwischen Proben für das Weihnachtskonzert, der Weihnachtsbasar, die Weihnachtsfeier. Für alles wird man wie selbstverständlich eingeplant, ohne dass man gefragt wird. Und so findet man sich im Handumdrehen mit einer Reihe von zusätzlichen Mini-Jobs, die man eigentlich gar nicht schultern kann bzw. möchte. Nein sagen möchte man da. Und das habe ich dieses Jahr mehrmals getan. Und das hat mich sehr befreit. Und das so sehr, dass ich dem Nein ein eigenes Kapitel widmen möchte.
Nein.
In meiner Funktion als Systembetreuer bin ich für viele Leute gefühlt für alles zuständig, was ein Kabel hat:
Mein Privatrechner geht nicht, schau doch mal. In Raum 120 geht das Licht nicht (indirekter Sprechakt deutlich hörbar). Das WLAN ist ausgefallen. Der Strom ist ausgefallen im Erdgeschoss. Der Gong geht nicht im Musiksaal. Kannst du mich für das Infoportal entsperren, ich hab dreimal das falsche Passwort eingegeben. Wie viele dieser geschilderten Situationen der letzten zwei Monate sind tatsächlich meine Aufgabe? Antwort: Keine einzige. Also weg damit.
Nein.
Ebenso geneint wurde bei Dingen, die ich aus Überzeugung und Idealismus zusätzlich übernehme – und das hat tatsächlich ein bisschen weh getan, da ein Nein dort auch ein bisschen ein Eingeständnis ist. Ein Nein zum AK Medien, weil im Moment kaum Leute zu den Fortbildungen kommen (die anderen AKs haben ähnlich wenige Besucher gerade, aber ich weigere mich ein aktuell totes Pferd zu reiten). Ebenso auch teilweise Nein zu meinen geliebten Medienwarten, die ich ehrenamtlich zur Unterstützung im Unterricht bei Problemen mit der Technik ausbilde. Die habe ich jeden Monat 90 Minuten in meiner Freizeit geschult. Daraus wurde jetzt kurzerhand ein Turnus von sechs Wochen. Allem voran deshalb, weil die Technik mittlerweile zuverlässig läuft, sodass wir nicht ständig nach dem Rechten sehen müssen. Zum anderen, weil jede Sitzung eine gewisse Vorplanung mit Portalnachrichten ans Kollegium, Stundenplanern, eMails an die Eltern und die Schülerschaft selbst einfordert, die in einem stressigen Schultag einfach mal en passant passieren muss. Die Medienwarte waren zu Beginn sehr erstaunt, dass ich das alles etwas zurückgefahren habe, weil man das von mir so nicht kennt. Aber es geht gefühlt auch so. Dank Nein.
Für mich sind das tatsächlich neue Verhaltensmuster. Und bis die sitzen, dauert es. Aber ich bin auf einem guten Weg. Die Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche haben dadurch deutlich abgenommen. Die Arbeitsstunden nach Unterrichtsschluss ebenfalls. Und ich kann mich wirklich auf mein Kerngeschäft konzentrieren. Und tatsächlich auch auf etwas Freizeit in der Schule.
Ja.
Ja zum Lehrerchor. Dadurch, dass ich mich an manchen Stellen deutlich freigestrampelt habe, finde ich auf einmal Zeit für lange verschollene Tätigkeiten, die ich aus Zeitgründen an den Nagel gehängt habe. Den Lehrerchor zum Beispiel. Da bin ich vor knapp vier Jahren raus, weil ich in dem ganzen Schulchaos irgendwann nicht noch einen Termin haben wollte, den ich aufgrund der sonst noch so dräuenden Aufgaben einfach als Belastung empfunden habe. Auf einmal hatte ich wieder Zeit dafür. Und Spaß. Der Auftritt am Weihnachtskonzert letzte Woche war für mich ein Highlight des noch jungen Schuljahres, das ich gerne wiederholen möchte.
Ein dickes Ja bekommt aktuell auch der Unterricht, in dem es einfach läuft. Selbst der Informatikunterricht, den ich fachfremd unterrichte, ist durch die Verlagerung in einen digitalen Lernkurs komplett in den Händen der Kinder. In den Stunden selbst muss ich nichts machen, außer immer darauf hinweisen, dass alles, was zu tun ist, im mebis Kurs steht. Man muss halt lesen können. Diese komplette Eigensteuerung ist für unsere Kinder, die bei uns Frontalunterricht nicht nur gewöhnt sind, sondern auch sehr schätzen (weil man einfach vor sich hinpennen kann), ungewohnt. Wer die Lernvideos und Übungen der Vorstunde nicht durchgearbeitet hat, ist in der Folgestunde, wenn die Leute praktisch etwas erstellen sollen, total aufgeschmissen und sabottiert sich so die Note in Eigenregie. Das gab zu Beginn durchaus Diskussionen mit den Eltern. Aber spätestens, wenn die dann die klaren und für alle sichtbaren Arbeitsanweisungen und selbst erstellten Lernvideos zu dem Thema sehen, ist klar, wo der Hund begraben war.
Überhaupt fühlt es sich so an, als würden bei uns mehr und mehr Leute so langsam auf das digitale Pferd aufspringen. Unserem Aufruf zu einem Arbeitskreis, der die 1:1-Ausstattung in die Hand nehmen soll, die in Bayern ab dem nächsten Jahr verpflichtend umgesetzt werden soll, folgten erstaunlich viele Interessierte aus dem Kollegium. Mittlerweile sind wir ein Dutzend Leute. Angesichts unserer kompakten Schulgröße mit knapp über 40 Lehrkräften ist das enorm. Schauen wir mal, was daraus wird. Denn für einen Großteil ist das Thema immer noch sehr spooky.
Ich könnte natürlich noch viel mehr schreiben. Über mein mega tolles Team am ISB, das mir jeden Freitag gute Laune ins Gesicht zaubert. Die tolle Kollegin, mit der ich nun die sechste Unterstufe gemeinsam leite und mit der das Arbeiten einfach eine Wohltat ist. Oder von wertschätzenden Gesprächen mit Kollegen und Schulleitung. Aber das lasse ich. Aus Zeitgründen. Ich will ja was von den wohlverdienten Ferien haben.
Und deswegen übe ich mich lieber in meinem neuen Hobby.
Dem Nein-Sagen.
Nein.

Hast du eine Meinung dazu? Dann hinterlasse einen Kommentar oder eine Wertung.
 Oops, I did it again. Zum vierten Mal Korfu in vier Jahren. Tja, wenn Beamte reisen…
Oops, I did it again. Zum vierten Mal Korfu in vier Jahren. Tja, wenn Beamte reisen…




 Das Thema KI taucht bei mir aktuell noch nicht so wirklich häufig im Blog auf. Das hat seinen Grund. Als braver Beamter sind bei mir viele Abläufe derart eingeschliffen, dass ich im Schulalltag kaum darüber nachdenke, gewisse Schritte einfach an eine KI abzugeben. Einen Lückentext erstellen lassen? Ach quatsch, mach ich mal selber. Aus einem Video eine Listening Comprehension mit einem Mausklick designen? Iwo. Die paar Minuten Englisch-Video kann ich mir selbst anhören. Und das Hörverstehen mach ich auch. Das ging ja die letzten 15 Jahre auch.
Das Thema KI taucht bei mir aktuell noch nicht so wirklich häufig im Blog auf. Das hat seinen Grund. Als braver Beamter sind bei mir viele Abläufe derart eingeschliffen, dass ich im Schulalltag kaum darüber nachdenke, gewisse Schritte einfach an eine KI abzugeben. Einen Lückentext erstellen lassen? Ach quatsch, mach ich mal selber. Aus einem Video eine Listening Comprehension mit einem Mausklick designen? Iwo. Die paar Minuten Englisch-Video kann ich mir selbst anhören. Und das Hörverstehen mach ich auch. Das ging ja die letzten 15 Jahre auch.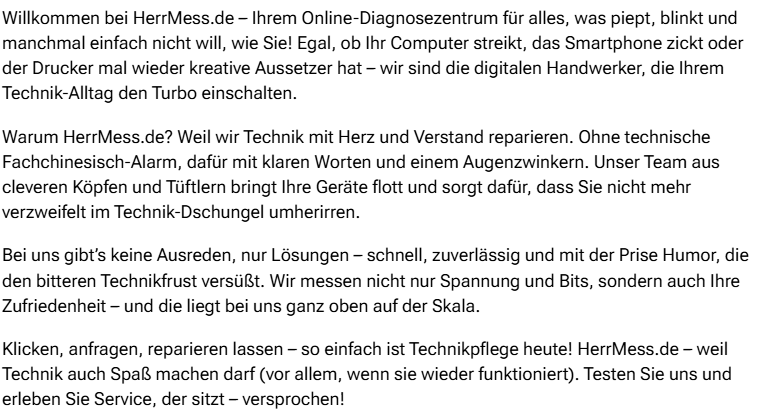
 Wie
Wie 
 Erster “echter” freier Tag in den Osterferien. Endlich mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Denn ähnlich wie Jan-Martin war gut was los die letzten Tage. Ausbildung der Referendare, ISB-Arbeit, Schulaufgaben, Englisch-Assignments, nebenbei die Organisation der Griechenlandfahrt und mitten in der Vorbereitung für die angedachte 1:1-Ausstattung mit digitalen Geräten an der Schule. Ach ja, und nebenher gebe ich in Vollzeit Kernfachunterricht 🤐
Erster “echter” freier Tag in den Osterferien. Endlich mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Denn ähnlich wie Jan-Martin war gut was los die letzten Tage. Ausbildung der Referendare, ISB-Arbeit, Schulaufgaben, Englisch-Assignments, nebenbei die Organisation der Griechenlandfahrt und mitten in der Vorbereitung für die angedachte 1:1-Ausstattung mit digitalen Geräten an der Schule. Ach ja, und nebenher gebe ich in Vollzeit Kernfachunterricht 🤐

 Letzte Woche fand ein Treffen für die Systemadmins der Münchner Gymnasien statt. Dort kommt man in illustrer Runde an einem schicken, präsentablen Standort zusammen und diskutiert aktuelle Probleme unserer Zunft, kommende Neuerungen, die derzeitige Arbeitslast und futtert sich währenddessen durch Berge von Häppchen (ich zumindest).
Letzte Woche fand ein Treffen für die Systemadmins der Münchner Gymnasien statt. Dort kommt man in illustrer Runde an einem schicken, präsentablen Standort zusammen und diskutiert aktuelle Probleme unserer Zunft, kommende Neuerungen, die derzeitige Arbeitslast und futtert sich währenddessen durch Berge von Häppchen (ich zumindest). Zeitgleich kam meine Mutter plötzlich mit einer Plastiktüte Nostalgie deluxe an: Knapp zwei Dutzend von Hörspielkassetten aus meiner Kindheit fanden sich darin, alles bunt durchgewürfelt: Pumuckl, kleine Hexe, der Schlupp vom grünen Stern, diverse Grimms-Märchen, Alice im Wunderland, Alf. Alles Perlen, die ich vermutlich seit 35 Jahren nicht mehr gehört habe. Aber damit ist diese Weihnachtsferien Schluss. Die Tage vor dem Jahreswechsel sind bei mir immer wieder mal von Nostalgie und einer gewissen Grundmelancholie geprägt, und diese blasts from the past heute sind die perfekte Gelegenheit sich nochmal ein bisschen dem Gefühl einer sorglosen Kindheit hinzugeben.
Zeitgleich kam meine Mutter plötzlich mit einer Plastiktüte Nostalgie deluxe an: Knapp zwei Dutzend von Hörspielkassetten aus meiner Kindheit fanden sich darin, alles bunt durchgewürfelt: Pumuckl, kleine Hexe, der Schlupp vom grünen Stern, diverse Grimms-Märchen, Alice im Wunderland, Alf. Alles Perlen, die ich vermutlich seit 35 Jahren nicht mehr gehört habe. Aber damit ist diese Weihnachtsferien Schluss. Die Tage vor dem Jahreswechsel sind bei mir immer wieder mal von Nostalgie und einer gewissen Grundmelancholie geprägt, und diese blasts from the past heute sind die perfekte Gelegenheit sich nochmal ein bisschen dem Gefühl einer sorglosen Kindheit hinzugeben.


