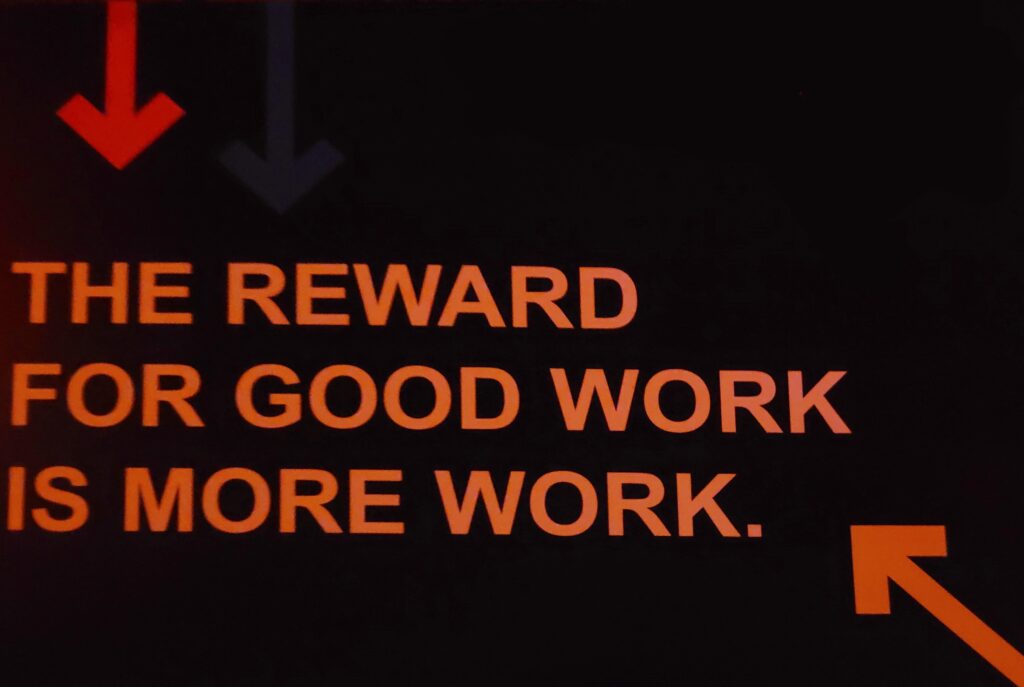Hass, Hass, Hass!!! Und das an den Weihnachtsfeiertagen! Keine Sorge, ich hab mich gleich wieder eingekriegt, ich will aber nur meinen Frust loswerden!
Hass, Hass, Hass!!! Und das an den Weihnachtsfeiertagen! Keine Sorge, ich hab mich gleich wieder eingekriegt, ich will aber nur meinen Frust loswerden!
Letzte Woche wurde ich von einer Freundin angesprochen, die in der Selbständigkeit arbeitet und eine neue Homepage für ihr Geschäft wollte. Viele ihrer Kollegen empfahlen, bei dem neuen Design einfach mal selbst Hand anzulegen und sich auf diese Weise ein paar Euro zu sparen. Naja, ganz so einfach war es scheinbar nicht, deswegen sprach sie mich letzte Woche an, ob ich mir das mal anschauen könne. Ihre Webseite laufe ja auf WordPress, und damit hätte ich ja Erfahrung wegen meines Blogs und so weiter. Machen wir’s kurz – wir wollen das ja in keinen Longread ausarten lassen – ich habe zusagt aus genau dem Grund, dass ich mich ja in WordPress einigermaßen auskenne… das dachte ich zumindest. Das ausgewählte Theme, das das Design der Homepage bestimmen soll, ist nämlich kein normales, wie das, auf dem herrmess.de läuft. Es ist… (dramatic drumroll) ein Block Theme – die Ausgeburt der Hölle.
Der Block-Blog: Wissenschaft für sich
Das Arbeiten mit Blöcken in Texten selbst ist in WordPress schon seit einiger Zeit implementiert und an sich eigentlich eine schicke Sache: Anstatt einfach nur wie üblich Text und Bilder zu verfassen und dann mit ein bisschen Handarbeit in eine Form zu bringen, dass die Leute nicht sofort schreiend davon laufen, übernehmen Blöcke dieses schicke Gestalten von alleine. Anhand von Template-Vorlagen kann man auf seiner Seite einen Text zusammen mit einem Bild platzieren. Hier ein Zitat, dort zwei Spalten, hier drei – jeweils mit einem korrekt zugeschnittenem Bild dazu, hier die Social Media dazugeklatscht, hier einen Trenner eingefügt, der dem Design Luft verpasst. Dass das alles gut aussieht, übernehmen diese Block-Templates von alleine. Die stammen nämlich von den Designern des Themes und haben in der Regel mächtig Ahnung von ansprechender Gestaltung. Nett, aber für mich bis dato überflüssig. Wir übrigens für viele andere auch, wie ich dem Mitgefühl auf Mastodon entnehmen konnte, das auf meine Wutausbrüche sehr verständnisvoll reagierte. Die meiden die Dinger ebenso. Und ich weiß mittlerweile auch warum.
Denn mit Blöcken alleine ist es nicht getan. Die – so dachte ich – kommen nur in Texten vor. Was ich nicht wusste: Es gibt komplette Themes, die mit Blöcken arbeiten: Menüs, Icons, Header, Footer, Seitenmenüs – alles ist Block Block Block. Und das funktioniert nach völlig neuen Regeln, die man nicht umgehen kann. Ein solches Theme mit dem alten Editor öffnen und benutzen funktioniert nämlich nicht. Keine Chance.
Dabei gab es an sich nicht viel zu tun. Es gab eine schicke Hauptseite und ein Topmenü, das die Icons und Menüs permanent am oberen Rand des Bildschirms festhalten sollte. Aber was für ein Durcheinander: Erst lässt sich das Menü problemlos erstellen, dann ist es plötzlich wieder weg. Es ist nämlich als Block nicht für die komplette Homepage, sondern nur für eine Seite als Menü definiert. Das Ding zu fixieren oder als allgemeingültige Vorlage abzuspeichern… nicht möglich. Auf Handy und Tablet war das Menü überhaupt nicht zu sehen. Also nie. Das liegt daran, dass man dieses Menü noch ein zweites Mal für mobile Devices erstellen und auf die Seite integrieren muss. Und plötzlich erscheinen die Menüs zweimal: Das Menü für Tablets sieht man auf den Tablets und Smartphones. Aber man sieht auch das Menü, das nur auf Desktop-PCs zu sehen sein sollte. Auf meinem Rechner sehe ich aber keines davon. Also fing ich an rumzuspielen und mich reinzufuchsen. So schwer kann das ja nicht sein. Mein Ehrgeiz war geweckt. Aber ich musste kapitulieren. Ihr wollt nicht wissen, wie viele Stunden ich jetzt mit diesem Mist verbracht habe, aber ich sage es euch. Sieben Zeitstunden. Sieben Stunden Lebenszeit. Unwiederbringlich verloren. Was ich gewonnen habe, ist eine ganze Menge Frust. Frust auf mich und meine scheinbare Beschränktheit, dieses System nicht zu verstehen, Frust auf dieses System aus der Hölle. Und natürlich auch Frust, meiner Freundin genervt sagen zu müssen, dass ich es nicht geschafft habe. Niederlagen eingestehen ist nicht so meine Stärke… Wie man sieht, weil ich offensichtlich nicht in der Lage, das mit mir selbst auszumachen, sondern mit der Welt zu teilen. Ob sie es hören mag oder nicht.
So.
Geht schon wieder.
Danke fürs Zuhören!



 “Haben Sie etwa ein rosarotes Hemd an!?” Die Empörung in der Stimme ist deutlich zu hören. Und am Gesichtsausdruck des Fünftklässlers, zu der sie gehört, auch zu sehen: Die Augen sind geweitet, der Mund steht offen. Es ist klar: Hier steht meine Autorität auf dem Spiel. Wenn ich das versaue, ist es um mich geschehen. Also gehe ich in die Offensive. Buchstäblich.
“Haben Sie etwa ein rosarotes Hemd an!?” Die Empörung in der Stimme ist deutlich zu hören. Und am Gesichtsausdruck des Fünftklässlers, zu der sie gehört, auch zu sehen: Die Augen sind geweitet, der Mund steht offen. Es ist klar: Hier steht meine Autorität auf dem Spiel. Wenn ich das versaue, ist es um mich geschehen. Also gehe ich in die Offensive. Buchstäblich.


 Jedem Anfang wohnt ein… Sie wissen schon. Aber neben Zauber gibt es natürlich auch eine gewisse Portion Nervosität zu Schuljahresbeginn: Wie wird es dieses Jahr? Passt der Stundenplan? Passen die Klassen? Passt die Arbeitsbelastung? Sind aus dem Nichts Unwägbarkeiten zu erwarten, die die komplette Planung durcheinander bringen?Um in derartigen Stürmen im Schuljahr die Kontrolle zu behalten, greifen wir seit jeher jedes Jahr auf Vorsätze zurück, auf die wir uns besinnen, wenn es denn mal so weit ist. Oder biegen sie uns zurecht. Oder ignorieren sie. Oder vergessen den einen oder anderen, weil man sich gar so viele vorgenommen hat.
Jedem Anfang wohnt ein… Sie wissen schon. Aber neben Zauber gibt es natürlich auch eine gewisse Portion Nervosität zu Schuljahresbeginn: Wie wird es dieses Jahr? Passt der Stundenplan? Passen die Klassen? Passt die Arbeitsbelastung? Sind aus dem Nichts Unwägbarkeiten zu erwarten, die die komplette Planung durcheinander bringen?Um in derartigen Stürmen im Schuljahr die Kontrolle zu behalten, greifen wir seit jeher jedes Jahr auf Vorsätze zurück, auf die wir uns besinnen, wenn es denn mal so weit ist. Oder biegen sie uns zurecht. Oder ignorieren sie. Oder vergessen den einen oder anderen, weil man sich gar so viele vorgenommen hat.